Basisdokumentation
Table Of Contents
- 1 Übersicht
- 2 Bedienung
- 3 Inbetriebnahme
- 4 Allgemeine Einstellungen
- 5 Allgemeine Funktionen, Grundlagen
- 6 Kesselregelung
- 6.1 Funktionsblock-Übersicht
- 6.2 Konfiguration
- 6.3 Kesselbetriebsarten und Kesselsollwerte
- 6.4 Freigeben und Sperren eines Kessels
- 6.5 Testbetrieb und Inbetriebnahmehilfen
- 6.6 Kesselschutzfunktionen
- 6.6.1 Maximalbegrenzung der Kesseltemperatur
- 6.6.2 Minimalbegrenzung der Kesseltemperatur
- 6.6.3 Optimierung Kesselminimaltemperatur
- 6.6.4 Kesselüberhitzungsschutz
- 6.6.5 Pumpenkick und Ventilkick
- 6.6.6 Frostschutz (Freigabe-Eing. Aus)
- 6.6.7 Anlagenfrostschutz Kesselpumpe
- 6.6.8 Kesselanfahrentlastung
- 6.6.9 Kesselabschaltung
- 6.6.10 Kesselfrostschutz
- 6.6.11 Rücklaufhochhaltung
- 6.6.12 Schutz vor Druckschlägen
- 6.7 Abgastemperaturüberwachung
- 6.8 Abgasmessbetrieb
- 6.9 Kesselstörung
- 6.10 Brennerbetriebsstunden-Zähler und Brennerstart-Zähler
- 6.11 Störungsbehandlung
- 6.12 Textbezeichnung für Kessel
- 6.13 Diagnosemöglichkeiten
- 7 Wärmebedarf und Wärmeanforderungen
- 8 Hauptregler und Vorregler
- 9 Heikreisregelung
- 9.1 Funktionsblock-Übersicht
- 9.2 Konfiguration
- 9.3 Betriebsarten im Heizkreis
- 9.4 Raumtemperatursollwerte
- 9.5 Witterungsgeführte Heizkreisregelung
- 9.6 Mischerregelung
- 9.7 Optimierungsfunktionen
- 9.8 Begrenzungs- und Schutzfunktionen
- 9.9 Wärmebedarf
- 9.10 Zusatzfunktionen
- 9.11 Störungsbehandlung
- 9.12 Diagnosemöglichkeiten
- 10 Brauchwasserbereitung
- 10.1 Funktionsblock-Übersicht
- 10.2 Konfiguration
- 10.3 Betriebsarten und Sollwerte
- 10.4 Speicherladung
- 10.5 Direkte Brauchwasserbereitung
- 10.6 Legionellenschutz
- 10.7 Primärregelung
- 10.8 Begrenzungs- und Schutzfunktionen
- 10.9 Wärmebedarf
- 10.10 Brauchwasservorrang
- 10.11 Zusatzfunktionen
- 10.12 Störungsbehandlung
- 10.13 Diagnosewerte
- 11 Logikfunktionen
- 11.1 Logik
- 11.1.1 Aktivieren der Logik
- 11.1.2 Zuordnung von Texten
- 11.1.3 Einstellwerte Schaltwert Ein und Aus
- 11.1.4 Einschaltverzögerung / Ausschaltverzögerung
- 11.1.5 Minimale Einschaltdauer
- 11.1.6 Minimale Ausschaltdauer
- 11.1.7 Betriebsschalter
- 11.1.8 Verdrahtungstest
- 11.1.9 Prioritäten
- 11.1.10 Hinweise
- 11.1.11 Anwendungsbeispiel Speicherladung
- 11.1.12 Anwendungsbeispiel RS-Flip Flop
- 11.1.13 Anwendungsbeispiel solare Brauchwasserbereitung
- 11.2 Komparator
- 11.2.1 Aktivieren des Komparators
- 11.2.2 Zuordnung von Texten
- 11.2.3 Grenzwert oben und Grenzwert unten
- 11.2.4 Einschaltverzögerung / Ausschaltverzögerung
- 11.2.5 Minimale Einschaltdauer
- 11.2.6 Minimale Ausschaltdauer
- 11.2.7 Anzeigewerte
- 11.2.8 Verdrahtungstest
- 11.2.9 Prioritäten
- 11.2.10 Fehlerbehandlung
- 11.2.11 Anwendungsbeispiel solare Brauchwasserbereitung
- 11.1 Logik
- 12 Funktionsblock Zähler
- 13 Funktionsblock Diverses
- 14 Funktionsblock Störungen
- 14.1 Funktionsblock-Übersicht
- 14.2 Konfiguration
- 14.3 Störungstaste
- 14.4 Störungstaste extern
- 14.5 Störungseigenschaften
- 14.6 Zustandsdiagramme der einzelnen Störungsarten
- 14.7 Vordefinierte Störungseingänge
- 14.8 Störungseingänge
- 14.9 Kommunikation
- 14.10 Störungsrelais
- 14.11 Störungsanzeige
- 14.12 Löschen aller Störungsmeldungen
- 14.13 Diagnosemöglichkeiten
- 15 Kommunikation
- 16 Hilfestellung bei Störungssuche
- 17 Anhang
- Stichwortverzeichnis
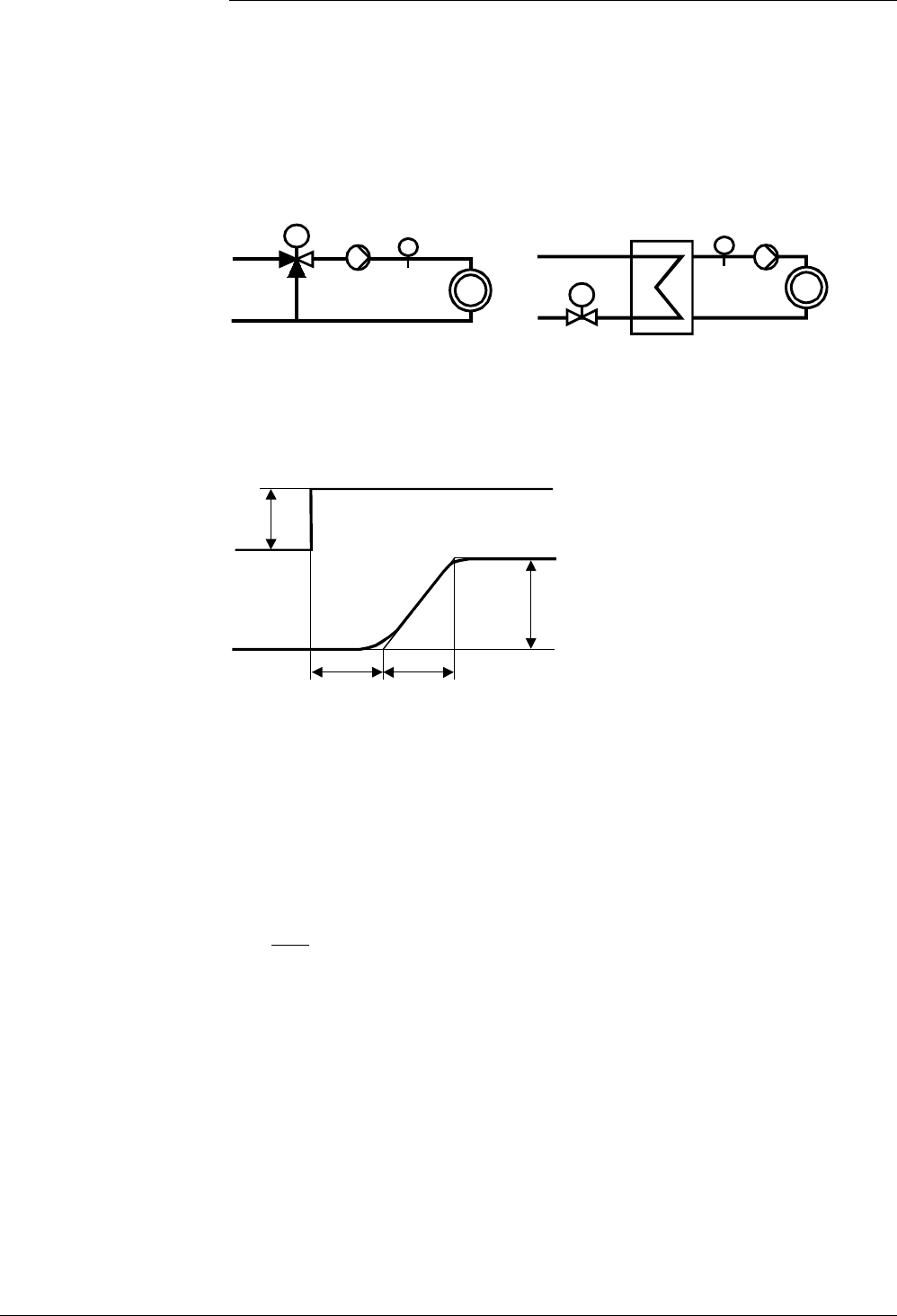
56/256
Siemens Modularer Heizungsregler RMH760B CE1P3133de
Building Technologies 5 Allgemeine Funktionen, Grundlagen 2017-09-29
5.7.2 Einstellhilfen
Mit dem P-Band Xp und der Nachstellzeit Tn kann der Mischeralgorithmus optimal an
die Regelstrecke angepasst werden.
Die Einstellparameter sind im Auslieferungszustand so gewählt, dass die
Regelparameter für die meisten Regelstrecken (typischerweise
Vorlauftemperaturregelung mit einem Dreiwegmischer) geeignet sind.
Bei schwierigen Regelstrecken (z.B. Heizkreis mit Wärmetauscher) ist eine Anpassung
der Regelparameter an die Regelstrecke immer erforderlich.
3133D88
T
T
3133D89
Eine Regelstrecke wird üblicherweise durch die Sprungantwort charakterisiert. Dies
wird im nachfolgenden Beispiel eines Mischerheizkreises erläutert.
Das Stellglied (Mischerantrieb) soll zum Zeitpunkt t
o
von 40 % auf 80 % geöffnet
werden. Das hat zur Folge, dass sich die Vorlauftemperatur um den Wert Δx erhöht.
Ventilstellung
∆
x
Istwert
Tu Tg
∆
Y
Die Änderung der Ventilstellung
muss schnell erfolgen (von Hand)
3131D25
Tu
Verzugszeit
Tg
Ausgleichszeit
Δx
Istwertänderung
ΔY
Änderung der Ventilstellung
Je grösser die Totzeit im Verhältnis zur Streckenzeitkonstante ist, desto schwieriger ist
die Strecke zu regeln. Wirkt sich eine Änderung am Stellglied erst nach einiger Zeit am
Temperaturfühler aus, ist die Regelung wesentlich schwieriger, als wenn eine
Änderung unmittelbar erkannt wird.
Der Schwierigkeitsgrad
λ wird wie folgt berechnet:
λ
=
Tu
Tg
Für den Schwierigkeitsgrad einer Regelstrecke gelten folgende Richtwerte:
λ <0,1 = leichte Regelstrecke
λ 0,1…λ 0,3 = mittlere Regelstrecke
λ >0,3 = schwierige Regelstrecke
Die maximale Streckenverstärkung Ksmax lässt sich z.B. aus der Differenz zwischen
der maximalen Vorlauftemperatur vor dem Mischer und der minimalen
Rücklauftemperatur abschätzen. Dabei ist allenfalls noch ein Zuschlag für eine nicht
lineare Ventilkennlinie zu machen. TVmax = 80 °C und TRmin = 20 °C ⇒ Ksmax =
60 K.
P-Band: Xp = 2 × Tu / Tg ×
∆x / ∆y × 100 % ≈ 2 × Tu / Tg × Ksmax
Nachstellzeit Tn = 3 × Tu
Einstellmöglichkeiten
Einstellung mit Hilfe der
Sprungantwort
Beispiel
Schwierigkeitsgrad
Maximale
Streckenve
rstärkung
Ksmax
Einstellregeln










