Basisdokumentation
Table Of Contents
- 1 Übersicht
- 2 Bedienung
- 3 Inbetriebnahme
- 4 Allgemeine Einstellungen
- 5 Allgemeine Funktionen, Grundlagen
- 6 Kesselregelung
- 6.1 Funktionsblock-Übersicht
- 6.2 Konfiguration
- 6.3 Kesselbetriebsarten und Kesselsollwerte
- 6.4 Freigeben und Sperren eines Kessels
- 6.5 Testbetrieb und Inbetriebnahmehilfen
- 6.6 Kesselschutzfunktionen
- 6.6.1 Maximalbegrenzung der Kesseltemperatur
- 6.6.2 Minimalbegrenzung der Kesseltemperatur
- 6.6.3 Optimierung Kesselminimaltemperatur
- 6.6.4 Kesselüberhitzungsschutz
- 6.6.5 Pumpenkick und Ventilkick
- 6.6.6 Frostschutz (Freigabe-Eing. Aus)
- 6.6.7 Anlagenfrostschutz Kesselpumpe
- 6.6.8 Kesselanfahrentlastung
- 6.6.9 Kesselabschaltung
- 6.6.10 Kesselfrostschutz
- 6.6.11 Rücklaufhochhaltung
- 6.6.12 Schutz vor Druckschlägen
- 6.7 Abgastemperaturüberwachung
- 6.8 Abgasmessbetrieb
- 6.9 Kesselstörung
- 6.10 Brennerbetriebsstunden-Zähler und Brennerstart-Zähler
- 6.11 Störungsbehandlung
- 6.12 Textbezeichnung für Kessel
- 6.13 Diagnosemöglichkeiten
- 7 Wärmebedarf und Wärmeanforderungen
- 8 Hauptregler und Vorregler
- 9 Heikreisregelung
- 9.1 Funktionsblock-Übersicht
- 9.2 Konfiguration
- 9.3 Betriebsarten im Heizkreis
- 9.4 Raumtemperatursollwerte
- 9.5 Witterungsgeführte Heizkreisregelung
- 9.6 Mischerregelung
- 9.7 Optimierungsfunktionen
- 9.8 Begrenzungs- und Schutzfunktionen
- 9.9 Wärmebedarf
- 9.10 Zusatzfunktionen
- 9.11 Störungsbehandlung
- 9.12 Diagnosemöglichkeiten
- 10 Brauchwasserbereitung
- 10.1 Funktionsblock-Übersicht
- 10.2 Konfiguration
- 10.3 Betriebsarten und Sollwerte
- 10.4 Speicherladung
- 10.5 Direkte Brauchwasserbereitung
- 10.6 Legionellenschutz
- 10.7 Primärregelung
- 10.8 Begrenzungs- und Schutzfunktionen
- 10.9 Wärmebedarf
- 10.10 Brauchwasservorrang
- 10.11 Zusatzfunktionen
- 10.12 Störungsbehandlung
- 10.13 Diagnosewerte
- 11 Logikfunktionen
- 11.1 Logik
- 11.1.1 Aktivieren der Logik
- 11.1.2 Zuordnung von Texten
- 11.1.3 Einstellwerte Schaltwert Ein und Aus
- 11.1.4 Einschaltverzögerung / Ausschaltverzögerung
- 11.1.5 Minimale Einschaltdauer
- 11.1.6 Minimale Ausschaltdauer
- 11.1.7 Betriebsschalter
- 11.1.8 Verdrahtungstest
- 11.1.9 Prioritäten
- 11.1.10 Hinweise
- 11.1.11 Anwendungsbeispiel Speicherladung
- 11.1.12 Anwendungsbeispiel RS-Flip Flop
- 11.1.13 Anwendungsbeispiel solare Brauchwasserbereitung
- 11.2 Komparator
- 11.2.1 Aktivieren des Komparators
- 11.2.2 Zuordnung von Texten
- 11.2.3 Grenzwert oben und Grenzwert unten
- 11.2.4 Einschaltverzögerung / Ausschaltverzögerung
- 11.2.5 Minimale Einschaltdauer
- 11.2.6 Minimale Ausschaltdauer
- 11.2.7 Anzeigewerte
- 11.2.8 Verdrahtungstest
- 11.2.9 Prioritäten
- 11.2.10 Fehlerbehandlung
- 11.2.11 Anwendungsbeispiel solare Brauchwasserbereitung
- 11.1 Logik
- 12 Funktionsblock Zähler
- 13 Funktionsblock Diverses
- 14 Funktionsblock Störungen
- 14.1 Funktionsblock-Übersicht
- 14.2 Konfiguration
- 14.3 Störungstaste
- 14.4 Störungstaste extern
- 14.5 Störungseigenschaften
- 14.6 Zustandsdiagramme der einzelnen Störungsarten
- 14.7 Vordefinierte Störungseingänge
- 14.8 Störungseingänge
- 14.9 Kommunikation
- 14.10 Störungsrelais
- 14.11 Störungsanzeige
- 14.12 Löschen aller Störungsmeldungen
- 14.13 Diagnosemöglichkeiten
- 15 Kommunikation
- 16 Hilfestellung bei Störungssuche
- 17 Anhang
- Stichwortverzeichnis
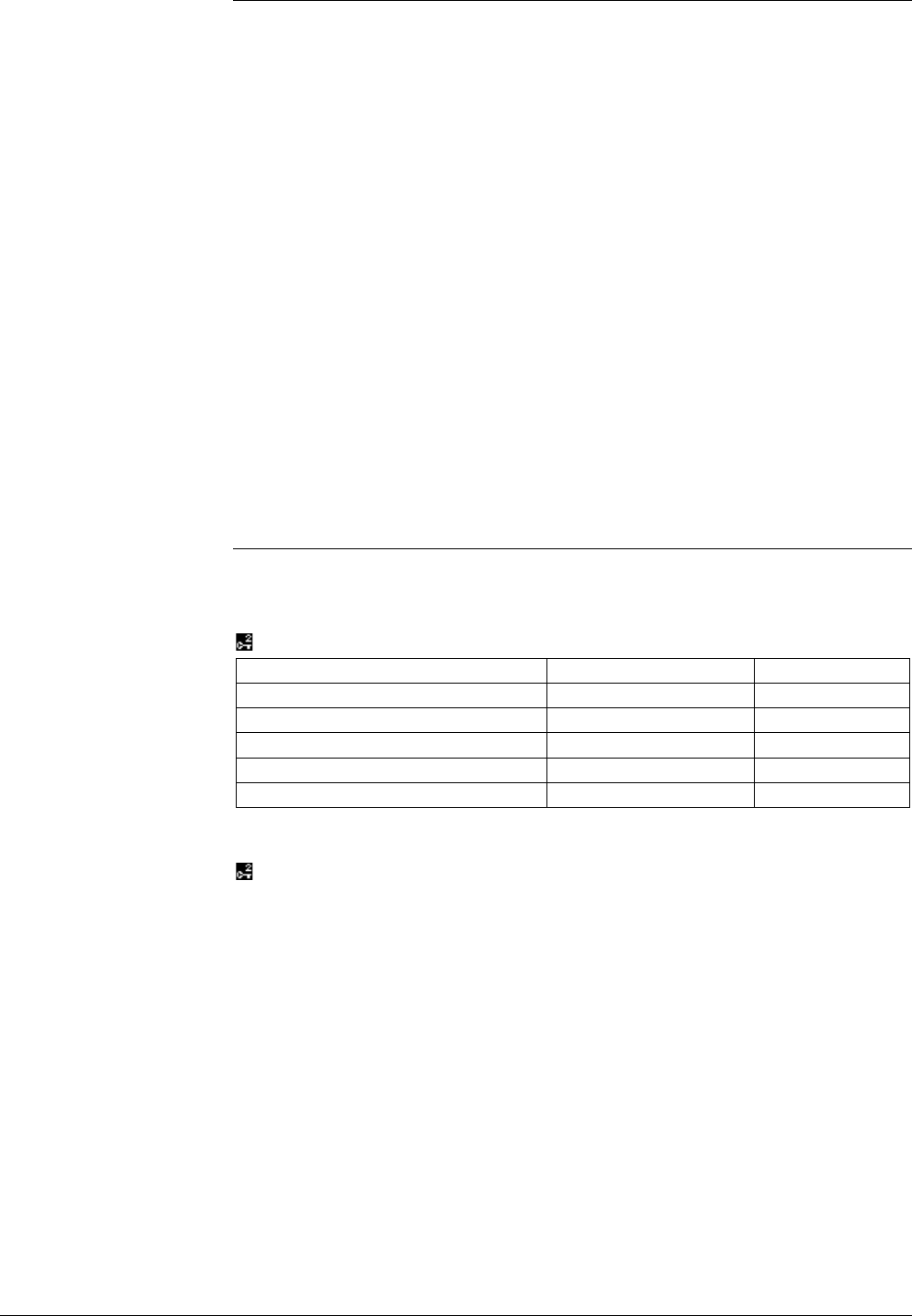
218/256
Siemens Modularer Heizungsregler RMH760B CE1P3133de
Building Technologies 15 Kommunikation 2017-09-29
15 Kommunikation
Eine ausführliche Beschreibung der Kommunikation ist in der Basisdokumentation
P3127 "Kommunikation über KNX-Bus" zu finden. Im Folgenden sind die wichtigsten
Einstellungen beschrieben, die für die Inbetriebnahme einer einfachen Anlage
erforderlich sind.
Die Kommunikation ist aktiviert, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:
• Die Geräteadresse ist eingegeben (jeder Busteilnehmer benötigt eine individuelle
Geräteadresse)
• Die Busspeisung ist vorhanden
• Das Busgerät ist nicht im Inbetriebnahme-Mode
Der Datenaustausch der für die Heizungs- und Lüftungstechnik relevanten Daten
erfolgt im LTE-Mode (Easy-Mode). Dieser Mode ermöglicht einen einfachen
Datenaustausch ohne aufwändiges Engineering.
Gleichartige Daten werden innerhalb von Zonen ausgetauscht. Das Erstellen einer
gemeinsamen Zone genügt deshalb, um die Kommunikation zu ermöglichen.
Die Gerätezuordnung der Anlagen spielt keine Rolle. Die Anlagen können sich auf
demselben RMH760B oder in verschiedenen über den Bus verbundenen KNX-Geräten
befinden.
15.1 Grundeinstellungen
Bevor die Zonen-Zuordnungen für den Austausch der Prozessdaten gemacht werden,
ist die Geräteadresse einzustellen.
Hauptmenü > Inbetriebnahme > Kommunikation > Grundeinstellungen
Bedienzeile
Bereich
Werkeinstellung
Geräteadresse
1…253 (1…255)
255
Busspeisung dezentral
Aus / Ein
Ein
Uhrzeitbetrieb
Autonom / Slave / Master
Autonom
Uhrslave-Fernverstellung
Ja / Nein
Ja
Störung-Fernentriegelung
Ja / Nein
Ja
Die hier vorgenommenen Einstellungen werden auch angezeigt unter:
Hauptmenü > Geräte-Informationen > Kommunikation > Grundeinstellungen
Jeder Busteilnehmer benötigt eine individuelle Geräteadresse.
Die Geräteadressen 254 und 255 sind für spezielle Funktionen reserviert. Mit der
Geräteadresse 255 ist die Kommunikation deaktivert (kein Prozessdatenaustausch).
Für kleine Anlagen (max. 8 Geräte) kann mit der dezentralen Busspeisung gearbeitet
werden. Das entspricht der Werkeinstellung). Einzelheiten enthalten das Datenblatt
N3127 (KNX-Bus) oder die Basisdokumentation P3127 (KNX-Kommunikation).
Mit der Einstellung "Autonom" empfängt oder sendet das Gerät keine Uhrzeit. Soll im
System eine gemeinsame Uhrzeit verwendet werden, wird ein Gerät als Uhrzeit-Master
definiert und die anderen als Slaves.
Die Funktion "Uhrslave-Fernverstellung" ermöglicht es dem Bediener, bei einem
Uhrzeit-Slave die Uhrzeit und das Datum einzustellen.
Aktivieren der
Kommunikation
Prozessdatenaustausch
Kommunikation
Geräteadresse
Dezentrale Busspeisung
Uhrzeitbetrieb
Uhrslave-Fernverstellung










